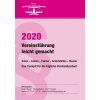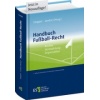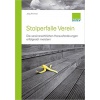Vereins- & Sportrecht
Für Ihren (Sport-)Verein sind Fragen des Vereins- und Sportrechts besonders interessant. Worauf Sie achten müssen, wenn sich Ihre Satzung ändert oder die Stellung Ihres Sportvereins innerhalb des Sportbundes, darüber hält Sie der VVS mit aktuellen Urteilen immer auf dem Laufenden.
Unsere Vereins-Rechtstipps
Welche Anforderungen gibt es an den Sitz des Vereins?
Hybride Mitgliederversammlung: Bundestag beschließt Gesetz
Abberufung des Vorstands kann en bloc erfolgen
Mitgliederversammlung - Tagesordnungspunkte: Gegenanträge sind anzunehmen
Darf ein Verein wegen Corona seine Vereinstätigkeit einstellen?
In diesen Fällen sind Tagesmitgliedschaften zulässig
Mitgliederversammlung: Wann hat ein Mitglied Anspruch auf eine geheime Abstimmung?
Fehlende Kenntnis der Satzung geht zulasten des Mitglieds
Vereinsausschluss: Generalklausel darf nicht zu allgemein sein
Wollen Sie mehr und aktuelle Informationen?
 Dann bestellen Sie die vierteljährlich erscheinende Rechtssprechungsübersicht direkt in unserem Shop im Jahresabo zum Preis von 48,00 € zzgl. 6,00 € Versandkosten. Sie erhalten dann ab der kommenden Ausgabe 4 mal im Jahr 16 Seiten aktuell recherchierte und kommentierte Urteile zur Vereins- und Verbandsarbeit.
Dann bestellen Sie die vierteljährlich erscheinende Rechtssprechungsübersicht direkt in unserem Shop im Jahresabo zum Preis von 48,00 € zzgl. 6,00 € Versandkosten. Sie erhalten dann ab der kommenden Ausgabe 4 mal im Jahr 16 Seiten aktuell recherchierte und kommentierte Urteile zur Vereins- und Verbandsarbeit.
Noch nicht überzeugt? Wir bieten Ihnen eine kostenlose Leseprobe ebenfalls in unserem Shop an (weiter unten).
Autor und Herausgeber der "Rechtsprechungsübersicht" ist Stefan Wagner, Jurist, Dozent an der Führungsakademie des DOSB in Köln, Referatsleiter in der Staatskanzlei in Dresden und Mitautor des Loseblattwerks "Der Verein".